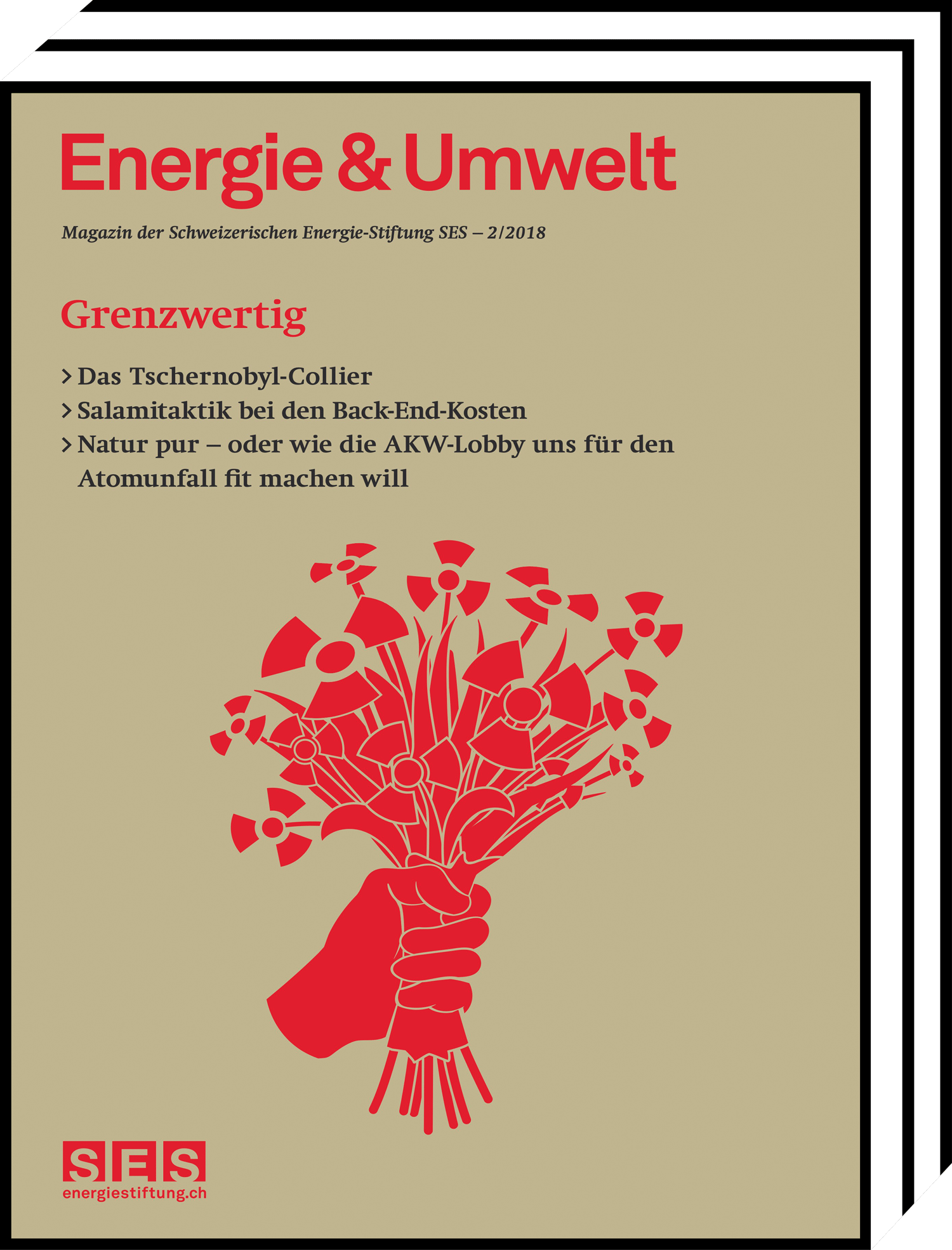
Das Tschernobyl-Collier
1986 hielt die Welt den Atem an und schaute nach Tschernobyl: Tagelang brannte ein Reaktor des Kernkraftwerks und verstrahlte eine ganze Region auf unbestimmte Zeit. Die Radiobiologin Natalia Manzurova erinnert sich.
Von Anja Boromandi*
Auf dem Tisch neben ihr liegt eine kleine Blechdose. Immer wieder greift Natalia Manzurova in sie hinein und nimmt eine Tablette heraus. Am Hals der zierlichen Radiobiologin aus Russland ist eine blasse strichförmige Narbe zu sehen. «Tschernobyl-Collier nennen wir das bei uns», scherzt sie müde lächelnd und schluckt ihre Arznei. Im April 2010 erhielt sie die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Danach, gesteht die 60-Jährige, sei sie wochenlang hysterisch gewesen. Obwohl sie immer mit der Erkrankung rechnen musste. «Aber wenn es dann wirklich so weit ist, will man es nicht wahrhaben.»
Umso weniger Verständnis hat sie für den Plan der ukrainischen Regierung, Tschernobyl für den Tourismus zu öffnen, um Devisen ins Land zu bringen. «Ich habe vom Sensationstourismus mit dem Geigerzähler gelesen und bin entrüstet. Ein Besucher meinte: < Ich war da drin und will da wieder hin. > Als ob man Rodeln oder Skifahren gehen würde», sagt sie kopfschüttelnd. Natalia Manzurova ist eine von geschätzten 700'000 Liquidatoren, die nach der grössten bekannten Reaktorkatastrophe vor Ort waren – um dort «aufzuräumen».
Die Fotos und Bilder, die diesen Artikel illustrieren, entstanden 2016 aus dem Projekt «Recover – Streetart in Tschernobyl», bei dem das Künstlerduo Bane&Pest nach Pripjat reiste, um in der Geisterstadt Bilder zu malen. Das eindrückliche Vorhaben wurde in einem Film dokumentiert. Per VW Surf Bus reisten die zwei Streetart-Künstler von Budapest über Kiev nach Tschernobyl, an den Ort, an dem sich vor 30 Jahren die schlimmste Nuklearkatastrophe der Geschichte ereignet hat.
» pixel-love.ch
Viele ihrer Kollegen sind bereits verstorben. Natalia lebt. Über die körperlichen und seelischen Schmerzen redet sie nicht gerne, gesteht sie. Sie tut es dennoch und ist der Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Organisation «Women in Europe for a Common Future» nach München gefolgt. Um vor der teuflischen Gefahr zu warnen, die man nicht sieht, nicht riecht oder spürt: Vor der Radioaktivität, die ihr Schicksal und das ihrer Eltern bestimmt und geprägt hat.
Geboren wurde Natalia Manzurova in Osjorsk, nahe der ersten russischen Kernkraftanlage Majak. «Die baute die Regierung als Reaktion auf die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki. Meine Eltern haben über 40 Jahre an und in dieser Anlage gearbeitet, in der früher Plutonium für Atombomben produziert wurde. Mein Vater baute den ersten Reaktor mit, meine Mutter war in der Strahlenmesstechnik tätig», erinnert sie sich.
1957 ereignete sich in Majak der erste schwere Reaktorunfall der Kerngeschichte, der jedoch jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit verschwiegen wurde. Die Katastrophe war folgenreich für die Umwelt und die Menschen, vor allem für die Mitarbeitenden. Die Höchstdosis von 100 Röntgen hatte ihr Vater irgendwann um das Sechsfache überschritten, der Körper der Mutter war mit 400 Röntgen belastet. «Mein Vater galt damals als medizinisches Wunder, er hatte fast so eine Art Resistenz entwickelt», erzählt sie mit ruhiger Stimme. Ihre Mutter starb mit 62, der Vater mit 74.
Dennoch trat Natalia beruflich in die Fussstapfen ihrer Eltern. 1976 begann sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die Auswirkungen der Katastrophe von Majak zu untersuchen. «Durch unsere Erfahrungen, die wir im Ural gesammelt hatten, war unser Forschungsinstitut damals das einzige in der Welt, das wusste, wie Radioaktivität den Menschen und die Natur verändert.» Wie bald sie dieses Wissen brauchen würde, ahnte sie damals noch nicht.
Am 26. April 1986 passierte er, der GAU – der grösste anzunehmende Unfall. Vier Tage lang brannte der Reaktor 4 des Kernkraftwerks von Tschernobyl. Natalia Manzurova war zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt und alleinerziehende Mutter einer Tochter. Schon wenige Tage später, am 5. Mai, reiste sie mit Physikern, Chemikern und anderen Kollegen nach Prypjat. In einen nur vier Kilometer vom Reaktor entfernten Ort, in dem zuvor rund 48'000 Menschen gelebt hatten. Eine echte Wahl, den Auftrag abzulehnen, hatte sie nie: «Offiziell waren wir ja alle Freiwillige. Aber andererseits», relativiert sie, «fährt doch auch jeder Arzt, jede Ärztin ins Erdbebengebiet, wenn er gerufen wird, oder? Schon aus der Verpflichtung und Verantwortung heraus».
In einem ehemaligen Kindergarten richtete sie sich mit den KollegInnen ein Labor ein. «Als wir ins Gebäude kamen, fanden wir nur einen stark verbrannten Hund, der blind war. Es war ein schrecklicher Anblick», schildert die Wissenschaftlerin. In den kommenden Wochen und Monaten trifft sie immer wieder auf Tiere, deren zentrales Nervensystem angegriffen war und die die Tollwut hatten. «Ausserdem kreuzten sich Haushunde mit Füchsen und waren dadurch sehr gefährlich. Viele mussten wir erschiessen.»
Die Atmosphäre in Prypjat war gespenstisch. Obwohl Frühling war, herrschte Totenstille. Kein Vogelgezwitscher war zu hören. Natalia beschreibt die Situation als Vakuumglocke, die übergestülpt wird. «Alles stand da unberührt, als wäre man vom Himmel gefallen. Die Stimmung war unwirklich: Das neue Riesenrad auf dem Rummelplatz, das eine Woche später eingeweiht werden sollte, oder die Wäsche, die vor einem Haus an der Leine flatterte.»
Natalia leitete die Aufräumarbeiten. Anfangs durfte sie aufgrund ihres jungen Alters noch nicht zu nah an den Unglücksort, doch irgendwann, sagt sie, war das dann egal. «Ich wusste wie gefährlich das für mich war. Sobald die Belastung zu hoch war, wurden wir jedoch ausgetauscht. Der Rhythmus war: 15 Tage arbeiten, 15 Tage wegbleiben.» Der Schutzanzug, den sie bei der täglichen Arbeit trug, sparte nur die Partie um die Augen aus. Ihre Haut war von der Strahlung verbrannt. «Wie Milchschokolade sah das aus, auch die Brillengläser waren mit einer braunen Schicht überzogen.»
Mit einem speziellen Pflug begann ihr Team, die oberste Schicht der Erde abzutragen. Natalia nahm Bodenproben und erstellte zusammen mit den Strahlungsmesstechnikern eine Karte. Sie erfasste die Einrichtung der Häuser, um Schadenersatzforderungen festzuhalten. «Am Ende war der Regierung der Aufwand zu kompliziert, jeder bekam einfach pauschal 20'000 Rubel.» – Umgerechnet sind das 500 Euro !
Jeden Tag dekontaminierten Natalia und ihre Mitarbeitenden verstrahlte Gegenstände. Sie gruben grosse Löcher, betonierten sie aus, schütteten den Müll rein und planierten die Stelle zu. Hochradioaktive Dinge wurden mit Hilfe eines ferngesteuerten Fahrzeugs vergraben. So verschwanden ganze Siedlungen und Dörfer. Dazwischen gab es immer wieder Momente, die sich in ihren Kopf eingebrannt haben. Wie der, als sie in einem Gebäude Eimer mit toten Säuglingen und Föten fand. «Nach dem GAU gab es viele Abtreibungen per Kaiserschnitt», erklärt sie und fügt leise hinzu: «Nur ich weiss, wo sie begraben sind. Die Mütter würden sonst bestimmt zurückkommen.»
Das ganze Szenario, erzählt Natalia, habe sie an Krieg erinnert. Nur, dass die Menschen nicht fluchtartig gegangen seien. «Es gab keine Panik. Nach und nach kamen Busse aus Kiew und haben immer mehr Menschen weggebracht.» Sie musste zusehen, wie Kinder in Busse gesetzt und fortgefahren wurden. «Sie hatten keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr. Als ob eine Neutronenbombe explodiert wäre.» Die letzten BewohnerInnen verliessen erst rund ein Jahr später die kontaminierte Gegend. Was der Profitgier keinen Abbruch tat: Manche Anwohner, weiss sie, haben verstrahlte Kleider gesammelt und sie draussen verkauft.
Die offizielle Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern existiert heute immer noch. Nur einmal im Jahr, an Ostern, dürfen die ehemaligen BewohnerInnen einen Tag lang nach Prypjat zurück, um die Gräber der Angehörigen zu pflegen, die vor dem Unglück starben. Die Opfer des Reaktorunglücks hingegen werden bis heute alle auf einem eigens dafür angelegten Friedhof in Moskau beerdigt. Wie viele Tschernobyl-Opfer dort liegen, weiss Natalia nicht. Nur dass sie alle in Bleisärgen beigesetzt wurden.
Die Radiobiologin selbst ist heute invalide. Sie leidet neben ihrer Krebserkrankung am posttraumatischen Syndrom. Sie ist oft müde, hat Kopfschmerzen, ist erschöpft. 20 Mal wurde sie untersucht. Drei Jahre lang war sie ans Bett gefesselt und spielte mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. «Wie kannst du überhaupt noch arbeiten?, werde ich oft gefragt. Ihr seht mich ja nicht, wenn ich zwei drei Wochen, manchmal Monate im Bett liege, antworte ich dann.» Für ihren Einsatz bekam sie von Boris Jelzin eine Medaille. In Abwesenheit, weil sie krank im Bett lag! Sie lacht. «Eigentlich hätten sie mir, weil ich invalid bin, einen Orden geben müssen. Aber der, der mit der Übergabe der Dokumente für die Verleihung beauftragt war, hat sich selbst für den Tapferkeitsorden eingetragen und mich nur für eine Medaille.»
Kraft zum Weiterleben schöpft sie aus dem Glauben. «Meine Mutter gehörte zu den Altgläubigen, das ist eine besonders strenge Form der Orthodoxie. Ich habe einen Priester, mit dem ich mich regelmässig treffe. Was den Tod angeht, kann ich sagen, dass ich ihn überlebt habe. Ich war schon klinisch tot, doch auf dem Weg zum Himmel hat mich Gott wieder zurückgeschickt. Es scheint so, als habe ich noch eine Mission auf der Erde zu erfüllen.»
Eine davon ist ihr Brief an Angela Merkel, den sie zusammen mit der Umweltorganisation «Planet of Hope» aufgesetzt hat. Darin appelliert sie an die Bundeskanzlerin, die geplanten Castor-Transporte von Ahaus ins russische Majak zu verhindern.
*Die Autorin

Anja Boromandi
Dieser Artikel von Anja Boromandi, freie Journalistin aus München, ist 2011 im Buch «Tschernobyl für immer» von Peter Jaeggi erschienen. Wir danken für die freundliche Genehmigung für die erneute Veröffentlichung.

Abonnieren
«Energie&Umwelt»
Das Magazin der SES erscheint vier Mal jährlich. Sie können es als Print- oder Online-Ausgabe abonnieren.





